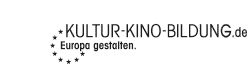Das Kommando der Pflegefabrik
Die Sprache im Pflegeheim verrät die Arbeitsbedingungen – Thema 03/13 Schutzbefohlen
Es ist immer noch das Modell der Fabrik, nach dem unsere Gesellschaft tickt. Doch während sich in der herkömmlichen Fabrik die ArbeiterInnen dagegen wehren, auf die Ware Arbeitskraft reduziert zu werden, ist das im Pflegebereich, in dem tayloristische Prinzipen auf den „Dienst an Personen“ angewandt werden, vertrackter. Hier werden Menschen als Arbeitskräfte wie auch Menschen als Arbeitsprodukte gleichermaßen einer Objektivierung preisgegeben. Aber Pflegekräfte können sich zumindest noch organisieren und gegen Arbeitshetze, stumpfsinnige Routinisierung oder körperliche wie seelische Belastung wehren. Pflegebedürftige alte Menschen sind dagegen häufig auf sich allein gestellt und der Vermassung und Depersonalisierung des Pflegebereichs mehr oder wenig ausgeliefert. Dies wird in den sprachlichen Konflikten zwischen Pflegepersonal und pflegebedürftiger Person besonders deutlich.
Die Sprache schreibt das Selbstverständnis von Pflegepatienten fest
Wir kennen ihn von unseren eigenen Krankenhausaufenthalten; wir erleben ihn, wenn wir Freunde und Verwandtein Pflegeheimen besuchen: den „Care-Speak“ mit seinen Infantilisierungen wie „Lätzchen“ oder „Pippi machen“, diesen „Baby-Talk“, mit hoher Intonation, kurzen, verniedlichenden Sätzen, mit diesen auf den bloßen Arbeitsvorgang zurechtgestutzten Anweisungen wie „Popo heben, Kopf drehen“ oder die peinigenden „Wir“-Anrufungen: „Wie geht es uns denn heute?“ Für pflegebedürftige Personen bedeutet dies, institutionellen Formen der symbolischen Gewalt und Diskriminierung ausgeliefert zu sein. Ihr Selbstverständnis als „alte“, „hilfsbedürftige“ Person, die nur noch eine Belastung für die Gesellschaft darstellt, wird so festgeschrieben. Diese Sprache der Pflegekräfte ist aber nicht Ausdruck eines bösen Willens oder bloße Übertragung von eigenen Ängsten vor dem Altern. Das Zurechtstutzen des Gegenübers zu einem „Pflegefall“, zu einem Objekt der Pflege, hat eine Doppelfunktion: Es schützt davor, zu sehr emotional involviert zu sein, was wiederum die Voraussetzung dafür ist, das Schritttempo in den Fabriken der Pflege aufrechtzuerhalten.
Mittlerweile haben sich Pflegeheime dieser Problematik angenommen und versuchen, ihrem Pflegepersonal etwas mehr „menschlichen Umgang“ einzuhauchen, indem sie dieses in Sachen Selbstreflektion, angemessener Sprache und Empathie unterrichten. Doch diese Aufforderungen bleiben Kosmetik, werden nicht auch die Verhältnisse mitdiskutiert, in denen diese Redeweisen erst eine Gewaltform annehmen. Zudem kommt hinzu, dass dieser sprachfixierte „menschliche Umgang“ zunehmend Pflegekräften mit Migrationshintergrund abverlangt wird, für die er eine Doppelbelastung darstellt. So werden das in Routinen gepresste Pflegepersonal und die pflegebedürftigen „Klienten“ gegeneinander ausgespielt. Solange sich die Arbeitsverhältnisse wie auch die institutionelle Anordnung in der Pflege nicht grundlegend ändern, wird der „richtige“ sprachliche Umgang immer wieder in das entmenschlichte Kommando der Fabrik zurückfallen.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

 „Der Missbrauch ist alltäglich“
„Der Missbrauch ist alltäglich“
Der Sozialpädagoge Claus Fussek fordert mehr Zivilcourage in der Altenpflege – Thema 03/13 Schutzbefohlen
 „Man muss Zwangsanwendung nüchtern diskutieren“
„Man muss Zwangsanwendung nüchtern diskutieren“
Für Detlef Silvers ist eine sorgfältige Abwägung der erste Schritt gegen Missbrauch – Thema 03/13 Schutzbefohlen
 Ausweitung der Grauzone
Ausweitung der Grauzone
Die Familie ist Teil europäischer Pflegemigration – Thema 03/13 Schutzbefohlen
 Es beginnt beim „Du“
Es beginnt beim „Du“
Missbrauch in der Pflege ist ein alltägliches Phänomen – THEMA 03/13 SCHUTZBEFOHLEN
Perfektes Versagen
Intro – Systemstörung
Drehtür in den Klimakollaps
Teil 1: Leitartikel – Hinter mächtigen Industrieinteressen wird die Klimakrise zum Hintergrundrauschen
„Kernziel der Klimaleugner: weltweite Zusammenarbeit zerstören“
Teil 1: Interview – Politologe Dieter Plehwe über die Anti-Klimaschutz-Bewegung
Dem Klima verpflichtet
Teil 1: Lokale Initiativen – Die Initative Klimawende Köln
Welt statt Wahl
Teil 2: Leitartikel – Klimaschutz geht vom Volke aus
„Nicht versuchen, die Industrie des 19. Jahrhunderts zu retten“
Teil 2: Interview – Meteorologe Karsten Schwanke über Klimaschutz und wirtschaftliche Chancen
Klimaschutz braucht (dein) Engagement
Teil 2: Lokale Initiativen – Die Bochumer Initiative BoKlima
Die Hoffnung schwindet
Teil 3: Leitartikel – Die Politik bekämpft nicht den Klimawandel, sondern Klimaschützer:innen
„Weit von einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit entfernt“
Teil 3: Interview – Die Rechtswissenschaftlerin Lisa Kadel über die Kriminalisierung von Klimaaktivist:innen
Klimaprotest im Wandel
Teil 3: Lokale Initiativen – Extinction Rebellion in Wuppertal
Klimaschutz als Bürgerrecht
Norwegen stärkt Engagement für Klimaschutz – Europa-Vorbild: Norwegen
Durch uns die Sintflut
Der nächste Weltuntergang wird kein Mythos sein – Glosse
Vorwärts 2026
Intro – Kopf oder Bauch?
Worüber sich (nicht) streiten lässt
Teil 1: Leitartikel – Wissenschaft in Zeiten alternativer Fakten
„Dass wir schon so viel wissen, ist das eigentliche Wunder“
Teil 1: Interview – Neurowissenschaftlerin Maria Waltmann über Erforschung und Therapie des Gehirns
Über Grenzen hinweg entscheiden
Teil 1: Lokale Initiativen – Das Experimentallabor Decision Lab Cologne
Mieter aller Länder, vereinigt euch!
Teil 2: Leitartikel – Der Kampf für bezahlbares Wohnen eint unterschiedlichste Milieus
„Glaubwürdigkeit ist ein entscheidender Faktor“
Teil 2: Interview – Sprachwissenschaftler Thomas Niehr über Sprache in Politik und Populismus
Im Krieg der Memes
Teil 2: Lokale Initiativen – Saegge klärt in Bochum über Populismus auf
Noch einmal schlafen
Teil 3: Leitartikel – Ab wann ist man Entscheider:in?
„Zwischen Perfektionismus und Ungewissheit“
Teil 3: Interview – Psychiater Volker Busch über den Umgang mit schwierigen Entscheidungen