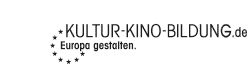„Radikalisierung beginnt mit Ungerechtigkeitsgefühlen“
Teil 3: Interview – Sozialpsychologe Andreas Zick über den Rechtsruck der gesellschaftlichen Mitte

choices: Herr Zick, Sie haben maßgeblich an der Studie „Die distanzierte Mitte“ mitgewirkt. Was erforscht die Studie?
Andreas Zick: „Die distanzierte Mitte“ ist eine Studie in der Reihe der „Mitte-Studien“, die von der Friedrich-Ebert-Stiftung beauftragt werden – unabhängig sind wir trotzdem, die Stiftung redet uns da nicht rein. Zentrale Idee der Mitte-Studien ist es, die Frage zu stellen, inwieweit rechtsextreme Orientierungen und Überzeugungen in der Mitte der Gesellschaft geteilt werden, in sie eindringen. Darum geht es vor allem in diesen Studien. Dann wird analysiert, warum das der Fall ist und was die Ergebnisse für die politische Bildung bedeuten. Wir haben uns für diese Studien beworben und vor einigen Jahren den Zuschlag bekommen, weil wir vor der Mitte-Studie die Langzeitstudie „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Deutschland“ durchgeführt haben, eine sehr erfolgreiche Studie, die von 2002 bis 2011 gelaufen ist und in der Reihe „Deutsche Zustände“ veröffentlicht wurde. Wir haben beide Studien zusammengeführt: Zum einen war es unser Ansatz, die rechtsextremen Einstellungen und Überzeugungen in der Mitte zu messen, auf der anderen Seite aber auch mitzunehmen, was den Rechtsextremismus im Kern ausmacht, eben die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das heißt, die Zuschreibung von Minderwertigkeit gegenüber sozialen Minderheiten im Land, zeigt eine ganze Palette von Vorurteilsmustern und Herabwürdigungen. Ohne die Menschenfeindlichkeit ist Rechtsextremismus nicht zu denken. Sie ist auch die Brücke in die Mitte. 2014 haben wir die erste dieser Studien durchgeführt, seitdem machen wir das im Zwei-Jahres-Abstand.
Im Kern ist es eine repräsentative Meinungsumfrage, die meisten werden das als Telefon-Interview kennen. Wir erheben dabei rechtsextreme Einstellungen und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und: Wir machen uns darüber Gedanken, welche anderen Einstellungen, Meinungen, Gedanken und Vorstellungen den Rechtsextremismus fördern. Das variieren wir je nach Zeitgeist, nach den Konfliktlagen, die sich im Land ergeben und wir fragen jedes Mal, wie wir die Mitte bezeichnen, gemessen an der Frage, inwieweit sie antidemokratische Einstellungen teilt. Bei der letzten Erhebung ist das Forschungsteam, das aus vielen Forschenden besteht, übereingekommen, die Mitte als „distanzierte Mitte“ zu bezeichnen. Ich hatte diesen Vorschlag gemacht, weil das zentrale Ergebnis für das Jahr 2023 – wir werden im kommenden November die nächste Mitte-Studie vorstellen – war, dass nicht nur die rechtsextremen Einstellungen angestiegen sind, sondern auch der Zuspruch zu rechtspopulären und autoritären Einstellungen. Vor allen Dingen haben wir gesehen, dass der Zuspruch zu Grundwerten und -normen, Offenheiten und Vielfalt, aber auch die Anerkennung der Würde aller rückläufig gewesen ist. Das hat mir in den Einstellungsmustern der Mitte gezeigt: Die Mitte zeigt in Teilen keine Verpflichtung mehr, sich an Kern- und Grundnormen zu halten – nicht die absolute Mehrheit, aber Teile der Mitte distanzieren sich von der Bindung an einen demokratischen Grundkonsens.
„Eine Mitte, die um Konsens ringt“
Was ist die politische „Mitte“ überhaupt?
Dieser Begriff der „Mitte“ ist in Deutschland enorm wichtig, muss aber zugleich auch immer wieder neu bestimmt werden. Es gibt viele Publikationen, die diese Frage stellen und letztendlich bleibt es ein „fuzzy concept“, ein schwer bestimmbares Konzept, gemessen an der Frage, wie die Menschen ihre politischen Ansichten selbst verorten. Es geht uns um die politische Mitte, eine Mitte, die Ausgleich sucht bei aller Vielfalt der Weltanschauungen und zugleich fähig ist, sich vom Extremismus abzugrenzen. Um das zu bestimmen, verwenden wir eine Skala, die von rechts über die Mitte bis nach links reicht. Seit vielen, vielen Jahren ordnet eine Mehrheit der Menschen ihre politische Einstellung in der Mitte ein – diese Mehrheit ist aber geschrumpft, es waren mal viel mehr. Inzwischen sagt noch jede zweite Person, ihre politischen Ansichten lägen genau in der Mitte. Es ist also eine politische Selbstverortung, die wir bewusst offenhalten, denn zur Mitte gehören erst einmal alle außerhalb des extremistischen Spektrums, das analysieren wir nicht – organisierte Links- oder Rechtsextremisten oder Islamisten betrachten wir in der Studie nicht. Zu dieser Mitte gehören alle, das ist sehr wichtig, denn es ist ein historisch gewachsenes Konzept: Weil wir ein föderales System haben, muss sich die deutsche Demokratie ständig bemühen, Interessengegensätze auszugleichen, etwa in der Bildungspolitik und in vielen anderen Bereichen. Dabei ist die Idee entstanden, dass es eine Mitte gibt, die immer wieder um diesen Konsens ringt.
Das ist die Grundlage für unser Mitte-Konzept. Wir bemessen es also nicht ökonomisch, nach Schichten, obwohl es immer noch einen überzufälligen Zusammenhang gibt zwischen der ökonomischen und der politischen Selbsteinstufung. Die Idee der Mitte ist also sehr zentral und darum bemühen sich Parteien auch stets darum, mit diesem Konzept Wähler zu werben, egal welche Weltanschauung sie haben. Wir haben jetzt einen Kanzler, der ganz deutlich im Wahlkampf hat verlautbaren lassen, seine Partei sei die Partei der Mitte, sein Programm sei das der Mitte. Frau Merkel hat oft nicht einmal ihr Parteilogo gezeigt, sondern einfach den Schriftzug „Die Mitte“. Wir haben in Deutschland keine Blockstellung in den Parlamenten, das ist in anderen Ländern anders, deswegen operieren wir mit diesem Konzept der Mitte. Aber genau das scheint heute weniger leicht als früher, denn wir haben jetzt etwa acht Prozent, die eindeutig rechtsextreme Einstellungen teilen, obwohl sie zur Mitte gezählt werden möchten. Das wirft die unangenehme Frage auf: Wie viel Extremismus wird eigentlich in der Mitte akzeptiert? Diese Entwicklung spiegelt sich auch in politischen Debatten wider. Wir haben jetzt eine zumindest in Teilen rechtsextreme Partei in den Landesparlamenten und dem Bundestag sitzen, die übrigens relativ selten von sich behauptet, die Partei der Mitte zu sein – auch das ist interessant, wird aber kaum diskutiert.
Obwohl sie für sich in Anspruch nimmt, die schweigende Mehrheit zu vertreten.
Genau, aber das, was sie als schweigende Mehrheit bezeichnet, bezeichnet sie eben nicht als Mitte. Sie verwendet diese Begriffe nicht deckungsgleich. Daran sieht man auch das demokratiestärkende Element des Mitte-Konzepts: Die Idee, um die Mitte zu werben, bedeutet auch immer Mäßigung, sich vom Extremismus fernzuhalten. Das heißt, dass auch Bürgerinnen und Bürger sich immer wieder darum bemühen müssen, ihre Einstellungen zu überprüfen, ob diese nicht auch in den Bereich des Extremismus fallen. Leider aber verändert sich dies gerade und darin liegt eine besondere Herausforderung: Hält dieses Konzept der Mitte, oder entwickeln wir uns wie andere europäische Länder, wie Schweden oder Belgien, zu einer Demokratie, die eher von einer politischen Blockstellung geprägt ist? Auch Menschen, die sich links oder rechts einordnen, gehören zu dieser Mitte, und tatsächlich ist diese Mitte auch ökonomisch noch stark von den Mittelschichten geprägt. Es aber allein am Einkommen fest zu machen, ist nicht die Tradition des Liberalismus oder der Demokratie. Historisch gehören wir aber alle zur Mitte. Es sind im Moment etwa 55 Prozent, die ihre Ansichten als „Mitte“ bezeichnen – 2014 waren es mal 61 Prozent. Vier Prozent sagen, sie sind rechts, ein Viertel sagt, eher rechts – das orientiert sich aber auch an der Mitte. Und dann haben wir noch 15 Prozent, die sich als eher links oder links bezeichnen.
„Viele Menschen glauben dem Populismus, dass sie ohnehin keinen Einfluss hätten“
Wie geht Radikalisierung vor sich? Wann verlässt jemand die Mitte?
Zunächst möchte ich betonen, dass wir seit Jahren einen Prozess der Radikalisierung der Mitte gesehen haben. Mit Radikalisierung meinen wir sonst eher andere Gruppen. Der Rechtspopulismus war entscheidend für die Radikalisierung. Seinen unglaublichen Anstieg im Einfluss auf die Mitte haben wir während der Pandemie gesehen. In der Mitte haben sich damals Überzeugungen herausgebildet, die nicht mehr klassisch rechtsextrem sind und die wir etwas umständlich "völkisch-autoritäre-rebellische" Einstellungen genannt haben. Das heißt, sie haben jetzt in der Mitte Leute mit Einstellungen, die massiv ihr Vertrauen in die staatlichen Institutionen verloren haben. Radikalisierung beginnt mit Ungerechtigkeitsgefühlen, aus denen Zweifel an der Demokratie erwachsen, die zu Misstrauen führen. Viele Menschen glauben dem Populismus darin, dass sie meinen, sie hätten ohnehin keinen Einfluss. Das bestärkt Gefühle der Ohnmacht, die die Öffnung für populistische und extreme Meinungen wie auch Verschwörungsglauben verstärkt. Diese Ohnmacht, die der Populismus verstärkt, greift er auf, indem er vermittelt: Leute, es ist alles noch viel schlimmer, als ihr denkt. Populismus und Extremismus operieren mit dem Misstrauen und überführt Menschen in die Distanz zur Demokratie. Menschen in der Mitte fangen an, ihr Misstrauen auf alle demokratischen Institutionen zu übertragen, auch auf die Medien, eben auf alles, was eigentlich die demokratische Vielfalt von Links bis Rechts repräsentiert. Dann öffnen sie sich alternativen Medien, alternativen Vorstellungen von Regierung und nehmen dann das Angebot des Extremismus wahr und bezeichnen die Distanzierung als Rebellion und legitimen wie notwendigen Widerstand. Die Organisatoren der „Querdenker“ haben während der Pandemie mit der Idee gespielt, das sie im Widerstand gegen das System sind, dass das Grundgesetz ausgehebelt wurde und die Gesetze nicht mehr gelten, das wird immer wieder suggeriert. Die AfD hat das aufgegriffen und ihrerseits die Distanzierung vorangetrieben mit Bezeichnungen anderer Parteien als „Kartell-“ und „Altparteien“. Viele Begriffe zeigen, dass Menschen ihr Demokratiemisstrauen als Akt des Widerstands verstehen.
Das ist ein Radikalisierungsmoment, in dem die Kritik an der Demokratie in radikale Gegenmodelle überführt wird. Was wir im Moment sehen, ist der Zauber alter, völkischer Vorstellungen, die den Rechtsextremismus immer schon ausgemacht haben: Es gibt Gruppen, die sind minderwertig, andere sind höherwertig. Höherwertig ist „das Volk“, die deutsche Nation. Dieser nostalgische Blick zurück – Grenzen zu schließen, Remigrations-Pläne und all das – und diese völkische Idee, die den Extremismus und historisch auch den Faschismus stark gemacht hat, greifen auf einmal, weil die Menschen sagen: Ich bin sowieso im Widerstand gegen das System, die lügen sowieso alle. Psychologisch betrachtet funktioniert die Radikalisierung in anderen Phänomenfeldern des Extremismus ähnlich: Erst einmal fühlt man sich ungerecht behandelt, dann sagt man, eigentlich ist das alles hier illegitim, die Legitimität der Demokratie an sich wird in Frage gestellt. Es kann sein, dass sich komplett neue Identitäten bilden. Menschen öffnen sich für politische Ideologien, wenn sie ein Angebot von Zugehörigkeit bekommen, ohne im Detail darüber nachzudenken, welche Konsequenzen einzelne Ideologien haben. Es kommt also darauf an, wie Menschen durch ihre Umgebung angesprochen und beeinflusst werden.
Woran macht sich die „Normalisierung“ von rechtsextremem Denken fest?
Vielleicht zunächst mal kurz erläutert, wie wir den Rechtsextremismus messen, wir machen das an der Zustimmung zu 18 Aussagen fest. Menschen haben dann eine manifeste, geschlossen rechtsextreme Einstellung, wenn sie diesen 18 Aussagen eindeutig zustimmen, voll, oder ganz zustimmen. Hier ein Beispiel, wie sich Rechtsextremismus normalisiert: Wir fragen nach der Zustimmung wie Ablehnung zu folgender Aussage „Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige, starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert“. Diese Aussage stammt aus den 1920er Jahren, das ist das, was die NSDAP gesagt hat: eine Partei verkörpert die Volksgemeinschaft – zu dieser Aussage haben wir eine Zustimmung von 24 Prozent. Das heißt, ein Viertel stimmt zu, das zeigt die Normalisierung. Die Normalisierung zeigt sich in der Akzeptanz solcher Aussagen in der Mitte wie aber auch in der Akzeptanz bestimmter rassistischer Bilder, etwa der Vorstellung, dass es wertvolles und unwertes Leben gibt.
Voll und ganz stimmen dem vielleicht nur 12 Prozent zu, aber Normalisierung funktioniert auch über einen Graubereich: Bei der ersten Aussage „Volksgemeinschaft“ kommen zu den 24 Prozent noch 19 Prozent hinzu, die „teilweise“ zustimmen, bei „unwertes Leben“ sind das noch einmal 12 Prozent. Das heißt, Normalisierung funktioniert über die Akzeptanz solcher völkischen, rassistischen und nationalistischen Bilder, von antisemitischen Einstellungen und über die schleichende Befürwortung von Vorstellungen wie „na ja, wir leben in Krisenzeiten, vielleicht ist eine Diktatur doch die bessere Regierungsform“, oder zumindest, dass sie auch nicht schlechter sei als andere. Wenn diese rechtsextremen Facetten in der Mitte akzeptiert werden, reden wir von einer Normalisierung. Wir beobachten seit sehr vielen Jahren wie sich traditionell rechtsextreme, nationalsozialistische Ideen normalisieren, indem sie in die Sprache eindringen und dort akzeptiert werden, indem sie in die Art und Weise einsickern, wie wir andere beschreiben.
„Die öffentlich-rechtlichen Medien haben vielleicht den Fehler gemacht, zu glauben, dass sich die Radikalen selbst entzaubern, wenn sie ihnen nur eine Stimme geben“
Welche Rolle spielen bei alldem die Medien?
Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Medienstudien und -analysen, die sich mit der These auseinandersetzen, dass die Menschen sich deswegen von der Demokratie distanzieren, weil sie ihre Meinung nicht in den Medien, zumindest nicht in den öffentlich-rechtlichen Medien, repräsentiert sehen. Das ist ja eine These, die immer wieder gesetzt wird, auch motiviert gesetzt wird, weil rechte wie linke radikale Kräfte immer wieder sagen, wir sind ja eigentlich Opfer der Medien und sind dort nicht repräsentiert. Die Medienstudien ergeben aber kein klares Bild und gerade öffentlich-rechtliche Medien sind gehalten, hinreichend zu repräsentieren und tun das ja auch. Ein anderer Prozess ist dabei nicht ganz unerheblich: In dem Ausmaß, in dem sich alternative Medien immer weiter etablieren, sinkt das Vertrauen in die herkömmlichen und öffentlich-rechtlichen Medien. Menschen öffnen sich vor allem dann für rechtsextreme Überzeugungen, wenn sie ihr Bild über Medien bekommen, die an Verschwörungsüberzeugungen andocken.
Das heißt, sobald Medien danach beurteilt werden, ob sie die eigene Meinung genau wiedergeben oder nicht, öffnen sich Menschen leichter für Kräfte die sagen, „deine Meinung wird hier eh nicht repräsentiert“. Rechtspopulistische Kräfte betonen immer wieder, sie würden in den Medien kaum oder nur verzerrt dargestellt, obwohl sie das oft genug tun, während sie gerade in den öffentlich-rechtlichen Medien zu sehen sind und dort reden können. Das scheint insbesondere junge Menschen zu beeinflussen, die eh in weiten Teilen politische Ansichten in Sozialen Medien entwickeln. Es war ein sehr auffälliger Befund der letzten Mitte-Studie wie anderer Studien, dass sich der alte Alterseffekt, nämlich dass Menschen mit höherem Alter konservativer werden und nach rechts rücken, zum ersten Mal gekippt ist: Jüngere Befragte stimmten deutlich häufiger Verharmlosungen des Nationalsozialismus, des Antisemitismus und des Rassismus zu, sie haben auch einen höheren Prozentsatz beim rechtsextremen Weltbild als die übrigen Alterskohorten.
Das ist nicht ganz uninteressant, wenn wir Befunde aus Jugendstudien wie der Shell-Jugendstudie heranziehen. Die haben genauer nach Medienkonsum und Medienwahrnehmung gerade von jüngeren Menschen gefragt: Dort hat man die Beobachtung gemacht, dass gerade politische Informationen in Medien gesucht werden, die zu den eigenen Einstellungen passen, obwohl gerade Jüngere sagen: Ob ich dem auch trauen kann, weiß ich nicht. Das heißt, viele junge Menschen konsumieren Informationen, von denen man selbst denkt, „na ja, vertrauenswürdig ist das vielleicht nicht“, aber es ist unterhaltend und interessant. Zugleich steigen unter jungen Menschen das politische Interesse wie eben auch die rechtsextremen Einstellungen. Eigentlich sollte mit steigendem Interesse auch eine steigende Demokratiebindung stattfinden, das tut es aber nicht mehr. Auf der einen Seite bemühen sich Medien, alle Spektren zu repräsentieren, aber die Konsument:innen auf der anderen Seite verhalten sich anders. Die öffentlich-rechtlichen Medien haben vielleicht auch den Fehler gemacht, zu glauben, dass sich die Radikalen schon selbst entzaubern werden, wenn sie ihnen nur eine Stimme geben – das stimmt eben nicht, weil Menschen diesen Zauber zum Teil gar nicht so schlecht finden.
„Die Mitte wird von rechts getrieben. Und sie lässt sich auf das Spiel ein“
Was kam zuerst: Der Rechtsruck oder die erfolgreichen Bemühungen rechter Parteien?
Ich glaube tatsächlich, jenseits aller Wahrnehmung, dass sich der Rechtsextremismus strukturell sehr gut verankert hat. Es gibt eine Wechselwirkung zwischen der Wahrnehmung der Menschen, die sich öffnen für Rechtsextremismus und der Toleranz gegenüber extremen Organisationen und Strukturen. Wo Rechtsextreme vor Ort sind, wo sie anfangen in der Bürgergesellschaft aktiv zu werden, dort rücken die Einstellungen oft nach – weil man sagt, „so schlimm sind die ja gar nicht“, „das wird man auch nochmal sagen dürfen“ und Ähnliches. In dem Ausmaß, in dem Rechtsextreme den Ton angeben, rücken Menschen in ihren Einstellungen und Wahrnehmungen nach. Darum kämpfen die Neurechten auch um die ideologischen Räume und ihre Vorzimmer. Erschwerend kommt hinzu, dass die Toleranz gegenüber Emotionen wie Wut und Hass und auch die Gewaltbilligung zugenommen haben. Wir haben gesehen, dass es nicht nur Vorurteilsmuster gegenüber vielen Minoritäten gibt, sondern dass auch der Umgangston rau und aggressiv wird. Das heißt, ich würdige nicht nur herab, ich stimme Vorurteilen nicht nur zu, sondern stimme auch Aussagen wie „da muss man jetzt mal was machen“ zu.
So erklärt sich meines Erachtens auch der große Erfolg der „Remigrations“-Kampagne: Dieses Konzept kommt ganz klar aus dem rechtsextremen Bereich und wird auf einmal im Bundestagswahlkampf in aller Breite diskutiert. Schon im letzten Jahr haben wir das bei den Europa- und Landeswahlkämpfen im Osten gesehen: Da haben die allermeisten Parteien mit Anti-Asyl-Kampagnen zu punkten versucht, das war das Thema Nummer eins – im Bundestagswahlkampf gab es dann praktisch nur das Thema Migration. Im Grunde genommen wird die Mitte von rechts getrieben, und sie lässt sich auf das Spiel ein. So wird Normalisierung dann auf einmal zum System. Plötzlich ist Migration bei allen Parteien Thema Nummer eins, dann gibt es auf einmal massive Grenzkontrollen usw. Die Rechtsradikalen verbuchen dann die Erfolge. Das heißt, es müssten sich tatsächlich alle fragen: Stammt das eigentlich aus einer urdemokratischen Überzeugung oder lässt man sich treiben von denen, die am lautesten schreien? Ich glaube, an dem Punkt sind wir tatsächlich gerade.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

 Ich, Menschenfeind
Ich, Menschenfeind
Intro – Rechtsabbieger
 von ch-thema-s1-678.jpg) Hakenkreuze auf dem Schulklo
Hakenkreuze auf dem Schulklo
Teil 1: Leitartikel – Wo Politik versagt, haben Rechtsextremisten leichtes Spiel
 von ch-thema-s2-678.jpg) „Man hat die demokratischen Jugendlichen nicht beachtet“
„Man hat die demokratischen Jugendlichen nicht beachtet“
Teil 1: Interview – Rechtsextremismus-Experte Michael Nattke über die Radikalisierung von Jugendlichen
 von ch-thema-s3-678.jpg) Zwischen Krawall und Karneval
Zwischen Krawall und Karneval
Teil 1: Lokale Initiativen – Der Bereich Gegenwart im Kölner NS-Dok klärt über Rechtsextremismus auf
 von tr-thema-s1-678.jpg) Die Unfähigkeit der Mitte
Die Unfähigkeit der Mitte
Teil 2: Leitartikel – Der Streit ums AfD-Verbot und die Unaufrichtigkeit des politischen Zentrums
 von tr-thema-s2-678.jpg) „Die Chancen eines Verbotsverfahren sind relativ gut“
„Die Chancen eines Verbotsverfahren sind relativ gut“
Teil 2: Interview – Rechtsextremismus-Forscher Rolf Frankenberger über ein mögliches Verbot der AfD
 von tr-thema-s3-678.jpg) Antifaschismus für alle
Antifaschismus für alle
Teil 2: Lokale Initiativen – Der Bochumer Antifa-Treff
 von en-thema-s1-678.jpg) Faschismus ist nicht normal
Faschismus ist nicht normal
Teil 3: Leitartikel – Der Rechtsruck in Politik und Gesellschaft – und was dagegen zu tun ist
 von en-thema-s3-678.jpg) Nicht mit uns!
Nicht mit uns!
Teil 3: Lokale Initiativen – Das zivilgesellschaftliche Netzwerk Wuppertal stellt sich quer
 von chtren-thema-europa-678.jpg) Stoppzeichen für Rassismus
Stoppzeichen für Rassismus
Die Bewegung SOS Racisme – Europa-Vorbild: Frankreich
 von chtren-thema-glosse-678.jpg) Wenn dir das reicht
Wenn dir das reicht
Demokraten und Antidemokraten in der Demokratie – Glosse
„Kernziel der Klimaleugner: weltweite Zusammenarbeit zerstören“
Teil 1: Interview – Politologe Dieter Plehwe über die Anti-Klimaschutz-Bewegung
„Nicht versuchen, die Industrie des 19. Jahrhunderts zu retten“
Teil 2: Interview – Meteorologe Karsten Schwanke über Klimaschutz und wirtschaftliche Chancen
„Weit von einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit entfernt“
Teil 3: Interview – Die Rechtswissenschaftlerin Lisa Kadel über die Kriminalisierung von Klimaaktivist:innen
„Dass wir schon so viel wissen, ist das eigentliche Wunder“
Teil 1: Interview – Neurowissenschaftlerin Maria Waltmann über Erforschung und Therapie des Gehirns
„Glaubwürdigkeit ist ein entscheidender Faktor“
Teil 2: Interview – Sprachwissenschaftler Thomas Niehr über Sprache in Politik und Populismus
„Zwischen Perfektionismus und Ungewissheit“
Teil 3: Interview – Psychiater Volker Busch über den Umgang mit schwierigen Entscheidungen
„Je größer das Vermögen, desto geringer der Steuersatz“
Teil 1: Interview – Finanzwende-Referent Lukas Ott über Erbschaftssteuer und Vermögensungleichheit
„Eine neue Ungleichheitsachse“
Teil 2: Interview – Soziologe Martin Heidenreich über Ungleichheit in Deutschland
„Die gesetzliche Rente wird von interessierter Seite schlechtgeredet“
Teil 3: Interview – VdK-Präsidentin Verena Bentele über eine Stärkung des Rentensystems
„Besser fragen: Welche Defensivwaffen brauchen wir?“
Teil 1: Interview – Philosoph Olaf L. Müller über defensive Aufrüstung und gewaltfreien Widerstand
„Als könne man sich nur mit Waffen erfolgreich verteidigen“
Teil 2: Interview – Der Ko-Vorsitzende des Bundes für Soziale Verteidigung über waffenlosen Widerstand
„Das ist viel kollektives Erbe, das unfriedlich ist“
Teil 3: Interview – Johanniter-Integrationsberaterin Jana Goldberg über Erziehung zum Frieden
„Mich hat die Kunst gerettet“
Teil 1: Interview – Der Direktor des Kölner Museum Ludwig über die gesellschaftliche Rolle von Museen
„Ich glaube schon, dass laut zu werden Sinn macht“
Teil 2: Interview – Freie Szene: Die Geschäftsführerin des NRW Landesbüros für Freie Darstellende Künste über Förderkürzungen